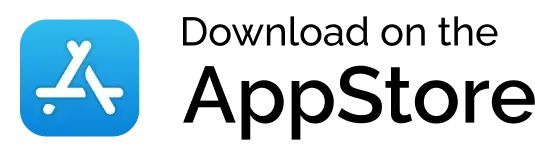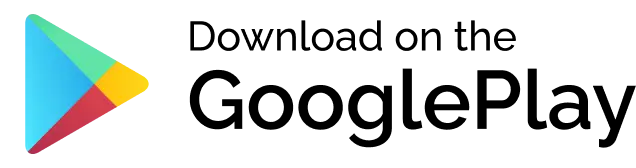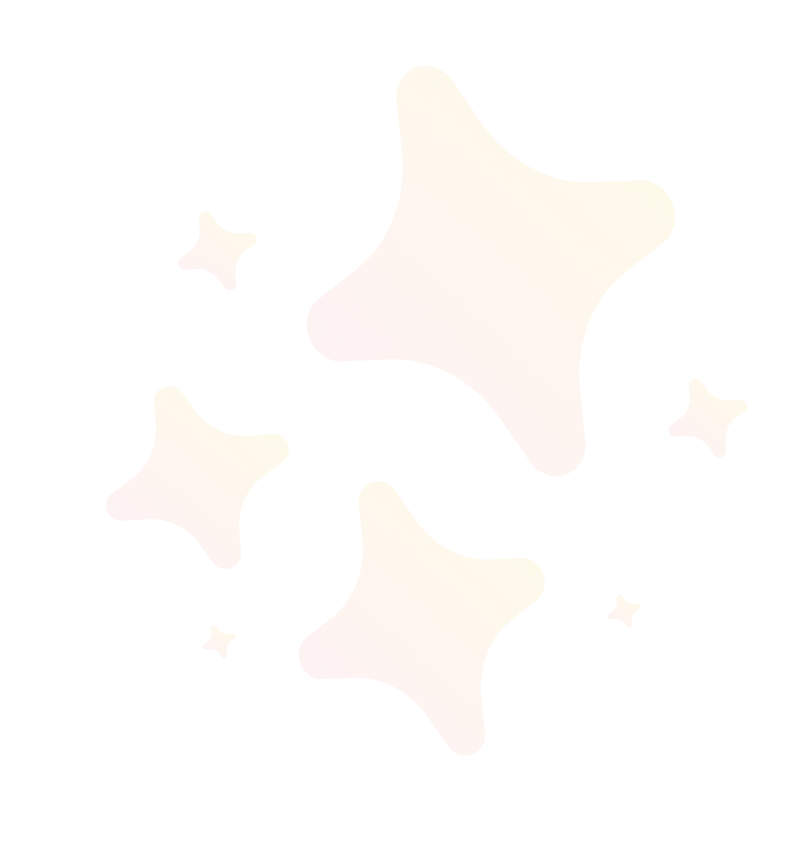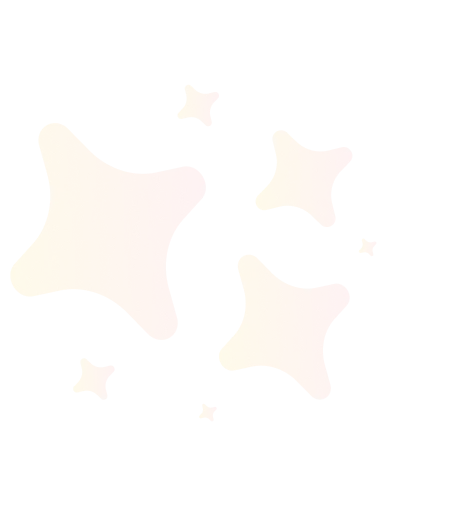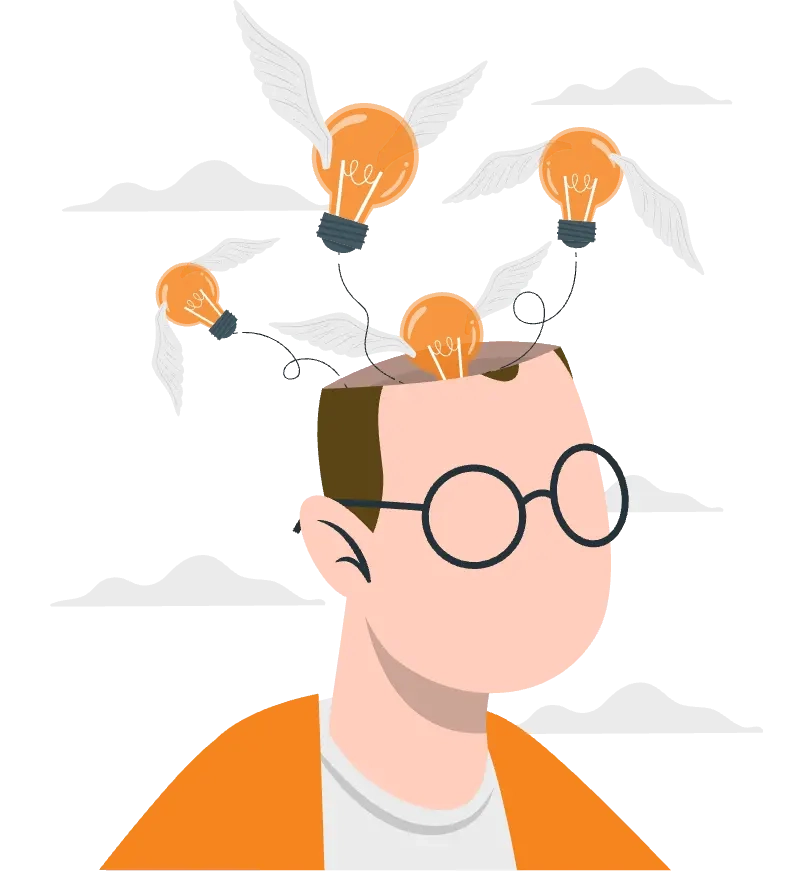Vielleicht fragen Sie sich: „Sollen wir uns jetzt einfach zwingen, ständig positiv zu denken?“ Also die Augen vor echten Schwierigkeiten verschließen, uns in ein rosarotes Wolkenkuckucksheim zurückziehen und uns einreden: „Alles ist gut, alles ist perfekt“?
Keineswegs!
KVT hat ungefähr so viel mit positivem Denken zu tun wie eine Computermaus mit einer echten Feldmaus.
Sehen wir uns das genauer an: Beide Konzepte teilen die Idee, dass unsere Wahrnehmung unsere Emotionen und unser Leben beeinflusst. Aber damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon.
Die Grundidee des positiven Denkens lautet: „Denke positiv!“ Die Grundidee der KVT hingegen ist: „Denke realistisch und anpassungsfähig!“
Bemerken Sie den Unterschied?
Mehr Inhalte in unserem app
Sie sehen nur einen Teil des Inhalts. In der App finden Sie zahlreiche interaktive Artikel. Außerdem gibt es psychologische Tests zur Verfolgung der Stimmungsdynamik, ein Tagebuch, ein Protokoll für automatische Gedanken und vieles mehr!

Positives Denken gründet sich darauf, nicht in Pessimismus zu verfallen und in jeder Lebenslage das Gute zu erkennen – in der festen Überzeugung, dass letztlich alles zum Besten führt.
Die kognitive Verhaltenstherapie dagegen legt den Schwerpunkt auf das Erkennen und Korrigieren kognitiver Verzerrungen (unproduktiver Gedanken und Überzeugungen), was in der Folge auch zu einer Verhaltensänderung führt.
Falls Ihnen diese Abgrenzung noch nicht ganz klar ist, lassen Sie es uns genauer fassen: Positives Denken fordert dazu auf, in jeder Situation das Gute zu suchen. Das kann sicherlich hilfreich sein, solange es nicht zu einem starren Denkstil wird.
Wir leben schließlich in einer Welt, in der es durchaus Unangenehmes und sogar Schlimmes gibt, oder? Schmerz, Traurigkeit, Misserfolge und Enttäuschungen gehören nun mal zum Leben dazu. Ohne die ginge es auch nicht, oder?
Wer also alles Negative zwanghaft durch Positive ersetzt, blendet einen Teil der Realität aus. Das hilft am Ende niemandem.
Positives Denken ermöglicht einem, alles falsch zu machen und dennoch zu glauben, man mache es richtig.
Steven Friesen
Ein Beispiel:
Angenommen, Ihnen widerfährt etwas Unangenehmes – zum Beispiel ein Jobverlust, eine Krankheit oder ein schmerzhaftes Beziehungsende.
Im Sinne des positiven Denkens müssten Sie dann all Ihre negativen Gedanken durch positive, optimistische Parolen ersetzen, etwa: „Denke bloß nicht an das Negative, es wird bestimmt alles gut!“
In der KVT hingegen gehen Sie anders vor: Zuerst nehmen Sie Ihre negativen Gedanken wahr, prüfen sie auf ihren Realitätsgehalt, betrachten Beweise und Gegenbeweise und ersetzen sie erst dann durch realistischere, angemessenere Überlegungen.
Beispielsweise so: „Ich kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass alles gut ausgeht, aber ich weiß auch nicht, ob wirklich alles schlecht wird. Es gibt mindestens drei Szenarien: das schlechteste, das beste und das realistischste. Ich kann mir überlegen, was ich in jedem Fall tun würde, damit ich für das Schlimmste gerüstet und auf das Beste hoffnungsvoll bin.“
Der Unterschied in der Herangehensweise ist beträchtlich, oder?
Die Fähigkeit, negative Gedanken im Licht dieser verschiedenen Möglichkeiten zu sehen, ist eine sehr effektive Technik. Wir widmen ihr sogar das nächste Kapitel!
Wenn wir Situationen von mehreren Seiten beleuchten, uns von Schwarz-Weiß-Bewertungen distanzieren und unser Denken auf rationale statt rein positive Weise verändern, können wir besser mit Emotionen und Problemen umgehen.